|
⇒ Startseite
|
⇒ Online-Shop
|
| ⇒ Autorinnen und Autoren |
⇒ Über den Verlag
|
| ⇒ Alle Bücher |
⇒ Newsletter |
Telefon: 02041 693588
|
E-Mail: post@vonneruhr.de |
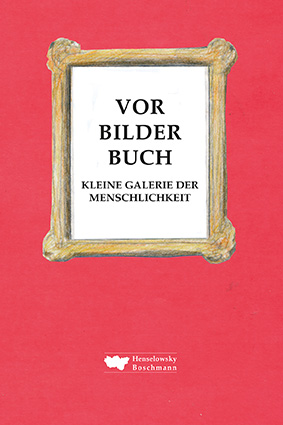 |
Vorbilderbildbuch
Kleine Galerie der Menschlichkeit
240 Seiten
· gebunden
mit Lesebändchen
Umschlag: Ilse Straeter
ISBN
978-3-942094-95-5
9,90 Euro
⇒ Das Buch im
Online-Shop bestellen
|
Wir
sind aus dem Ruhrgebiet, wir sind altmodisch, wir haben Vorbilder. Sie
bedeuten uns sehr viel. Denn wer keine Vorbilder mehr nötig zu haben
glaubt, der hat sich aufgegeben und ist auf dem Weg in die Barbarei. So
ist dieses Buch der Vorbilder auch
eine kleine Galerie der
Menschlichkeit.
|
Inhalt
Michael Zabka
Wer brauchen ohne „zu“ gebraucht
Monika Buschey
Spiel ist alles, Auf der Spur von Else Lasker-Schüler
Werner Streletz
Blankenburg
Zepp Oberpichler
Der Windmühlenmann
Markus Günther
Es zählt nicht, was wir sagen, sondern wer wir sind.
Über Clemens Kraienhorst
Sabine Herrmann
Kleine Onkelogie: Bänker mit Hirn und Herz
Jens E. Gelbhaar
Herr Jandrosch
Udo Feist
„Die leben ja wie die Urchristen!“ – Wenn man sie lässt
…
Anke Klapsing-Reich
Die „Pippi“ vom Grünen Weg
Annika Schuppelius
Erdbeereis auf Lebenszeit
Werner Bergmann
Ik sall denken!
Ulrich Straeter
Eine andere Welt ist möglich – hier: Antonio Gramsci
Sarah Micke
Ein Superheld für Erwin
Margret Martin
Eigentlich waren es drei
Gerd Herholz
Vorbildstörung
Karin Bucconi
Die Rockstars meines Lebens
Einhard Schmidt-Kallert
Father Merten – der Missionar und die Fetischpriester
Peter Bothe
Ein Torwart und ein 2:3 oder: Where are the
champions?
Werner Boschmann
Der Joseph, der Phil, die Frau Ebel und der Herr Schily, der Erich, der
Wilfried und der Sahin
Siegfried Stajkowski
Prof. Carlo Kreuzer oder: Der Lügenbaron aus Bochum
Susi Lilienfeldt
Surviving Kindertransportees
Hermann Beckfeld
Lebenskünstler. Grenzgänger. Kumpel.
Über Willi, der das Glück verschenkte
René Schiering
Was würde Schlingensief jetzt tun?
Hubertus A. Janssen
Irgendwo im Ruhrgebiet
Ludger Claßen
Tammaria
Thomas Rother
Ein zweites Künstlerleben. Werner Graeff und das Bauhaus
Ulrike Geffert
Adenauer! Oder vielleicht doch eher Che Guevara?
Klaus D. Krause
Der Klümpken-Fielosof
Herr Luca
Ruhender Pol
Margit Kruse
Der tolle Dieter, ein Ruhrpott-Cartouche
Joachim Wittkowski
Von Denkern und Lenkern
Jens Dirksen
Nachsatz zum Vorbild
|
|
⇒ Alle
lieferbaren Bücher
⇒ Impressum ⇒ Datenschutz
|

